Wir glauben oft, wir wüssten inzwischen viel über ADHS
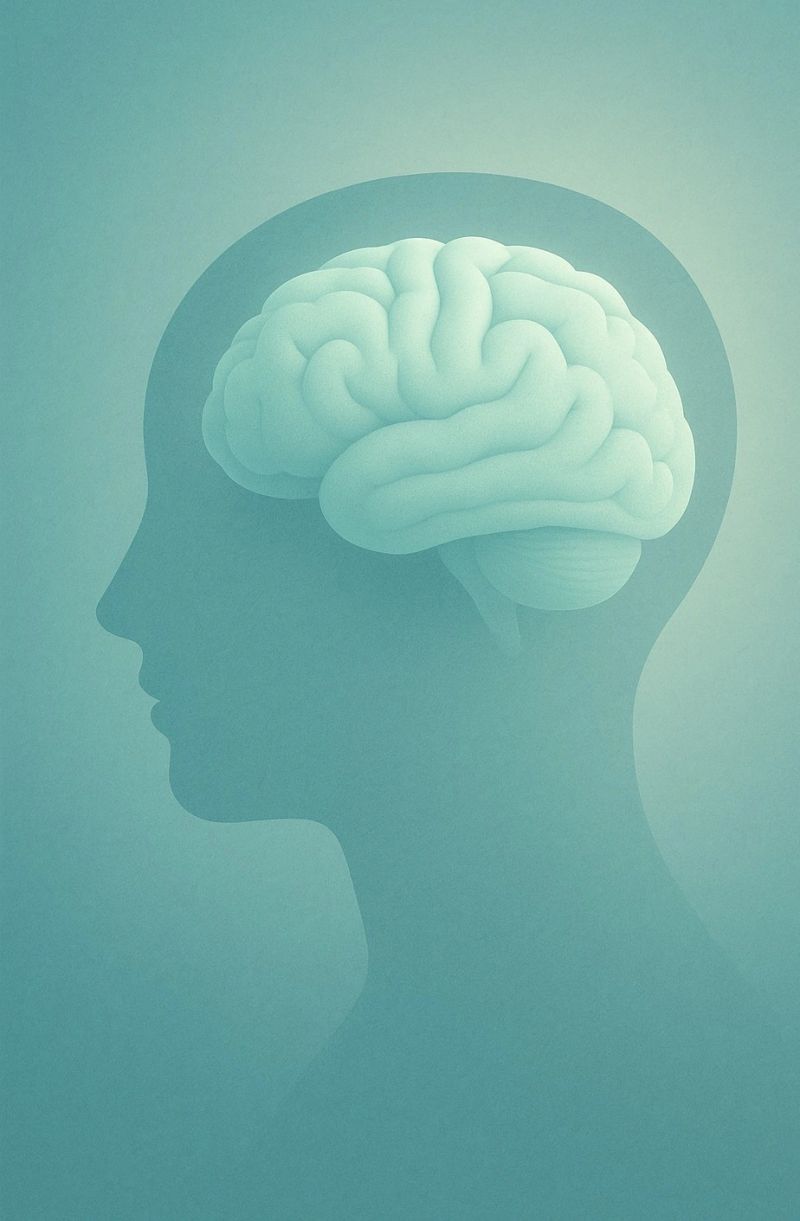
Wir glauben oft, wir wüssten inzwischen viel über ADHS. In Wirklichkeit stehen wir noch ganz am Anfang. Die gängigen Vorstellungen – von der „Zappeligkeit“, der Konzentrationsschwäche oder dem berühmten „Dopaminmangel“ – halten sich hartnäckig, auch in Fachkreisen. Doch aktuelle Studien, unter anderem aus Cambridge, zeichnen ein völlig anderes Bild.
Ein Forschungsteam an der University of Cambridge hat in bildgebenden Untersuchungen gezeigt, dass das zentrale Problem bei ADHS nicht ein Mangel an Dopamin ist, sondern eine fehlkalibrierte Regulation innerhalb dopaminerger Netzwerke. Das bedeutet: Das Gehirn reagiert nicht stabil auf Reize. Es filtert nicht nach Relevanz, sondern nach Reizstärke, emotionalem Gewicht oder Zufälligkeit.
Was dabei entsteht, ist kein „Defizit“ im klassischen Sinn, sondern eine Verschiebung in der Art, wie Prioritäten gesetzt, Impulse verarbeitet und Handlungen gesteuert werden. Das Belohnungssystem funktioniert unzuverlässig. Langfristige Ziele verlieren an Motivationskraft, kurzfristige Impulse übernehmen. Die Fähigkeit, Wichtiges zu starten, dranzubleiben oder überhaupt zu erkennen, was „dran“ ist, ist nicht schwach ausgeprägt, sondern anders organisiert.
Gleichzeitig zeigen die Studien aus Cambridge, dass bei ADHS strukturelle Unterschiede im Gehirn bestehen – insbesondere in der grauen Substanz, dort wo Exekutivfunktionen, Selbstregulation und Planung verortet sind. Es geht also nicht nur um Botenstoffe, sondern um eine andere neuroanatomische Architektur.
Trotz dieser Befunde behandeln viele Gesundheitssysteme ADHS weiterhin wie ein pädagogisches Problem oder eine Modeerscheinung. Die Folge: Betroffene – vor allem Frauen und nichtmännlich sozialisierte Menschen – erhalten ihre Diagnose oft erst nach Jahrzehnten innerer Überanstrengung.
Dabei wäre es höchste Zeit, umzudenken. ADHS ist keine Krankheit im klassischen Sinn. Neurodivergenz ist kein Trend. Es geht hier um reale Unterschiede in Wahrnehmung, Reizverarbeitung und Handlungsmotivation – die verstanden werden müssen, um passgenaue Unterstützung zu ermöglichen.
Was wir brauchen, ist ein Umdenken in Diagnostik, Sprache und Systemgestaltung. Eine Haltung, die neurodivergente Realität nicht normieren, sondern verstehen will. Denn das größte Risiko liegt nicht in der Neurodivergenz selbst – sondern in einem Umfeld, das sie ständig in Frage stellt.
Die Studienlage, unter anderem aus Cambridge, liefert längst die Grundlage dafür. Was fehlt, ist der Wille, sie ernst zu nehmen.
Quellenhinweis:
Robbins, Sahakian(University of Cambridge)
Forschungszusammenfassungen unter: https://lnkd.in/eGsJiXkk
ADHSNeurodivergenzCambridgeStudienForschungAufklärungPsychischeGesundheitADHSverstehenReizverarbeitungADHSImErwachsenenalterTraumasensibelWissenschaftLinkedInWissenNUKANUKANA
Hier geht’s zum NUKA-Newsletter
https://lnkd.in/dH9ez3DN


